
"Wien ist meine Stadt!": Burgtheater-Star Dörte Lyssewski
Mit der "freizeit" sprach die gefeierte Schauspielerin über die "letzten Tage der Menschheit", die für einen Höhepunkt der Salzburger Festspiele sorgen werden. Aber auch über charmante österreichische Gemeinheiten, und warum Cate Blanchett schnaufen darf, sie aber nicht.
Josef-Kainz-Medaille, Gertrud-Eysoldt-Ring, gleich zwei Mal den begehrten Nestroy-Preis – und erst heuer wurde sie zur Hörspiel-Schauspielerin des Jahres gekürt: Dörte Lyssewski gehört zu den höchstdekorierten Schauspielerinnen der Theaterstadt Wien.
Seit 2009 ist sie fixes Ensemblemitglied am Burgtheater – und eine der wenigen, die gleichermaßen im klassischen wie im zeitgenössischen Repertoire brillieren.
Nun steht sie in Karl Kraus’ eigentlich „uninszenierbarem“ Klassiker über das Schreckgespenst des Ersten Weltkriegs auf der Salzburger Festspielbühne der Perner-Insel. Im Gespräch geht sie auf diese neue, verdichtete Fassung ein, geht dem manipulativen Potenzial der Sprache auf den Grund und gesteht, warum sie an Wien – beinahe – alles liebt. Auch das Unaussprechliche.
Frau Lyssewski, in zwei Wochen hat die mit Spannung erwartete Neuinszenierung von „Die letzten Tage der Menschheit“ bei den Salzburger Festspielen Premiere. Worauf dürfen wir uns freuen? Werden wir Sie als skrupellose Kriegsjournalistin Alice Schalek sehen?
Ach nein! Die habe ich doch schon gespielt, das wäre ja langweilig. Das Konzept ist auch ganz anders als vor elf Jahren, als wir das Stück zum 100-jährigen Kriegsbeginn zuletzt gespielt haben ...
Worauf dürfen wir uns also freuen?
Man kann dieses ungeheure Stück nur immer wieder zu bändigen versuchen. Es wird diesmal auf jeden Fall konzentrierter, verdichteter. Das Stück ist ja derart gut und pointiert geschrieben, dass man ganz leicht Gefahr läuft, ...
... dass man ganz leicht Gefahr läuft, sich nur mehr in Ready-Mades zu bewegen, in Schablonen, also eine Aneinanderreihung von Kabinettstückchen zeigt. Da nickt man dann im Publikum und sagt „genau!“, bekommt aber nur zu hören, was man ohnehin weiß und kennt. Das versuchen wir zu unterlaufen, sodass man wirklich zuhört.

Dörte Lyssewski mit Maresi Riegner in Thomas Bernhards "Am Ziel" im Burgtheater
©(c) Susanne Hassler-SmithSie haben ja bereits erwähnt: 2014, bei der letzten Aufführung in Wien, war der Beginn des Ersten Weltkriegs genau 100 Jahre vorbei. Wie aktuell sind „Die letzten Tage der Menschheit“ heute?
Näher denn je, näher denn je ... Natürlich konnte man schon 2014 Parallelen sehen, da wurde von Russland ja auch ausgetestet, was möglich ist. Aber heute ist es eine ganz andere Dimension. Und diese Nähe entsteht auch durch die Sprache, die für Kraus ein ganz wichtiger Faktor war. Diese manipulativen, perfiden Aussagen von Politikern, Journalisten und Wirtschaftsmagnaten, die er im Stück ja teilweise wörtlich zitiert. Wenn wir heute hören, was aus Russland und den USA, aber auch von europäischen Politikern kommt – dann ist uns dieses Stück schon erschreckend nah. Und um auf die Schalek im Stück zurückzukommen: Bedenken Sie, was heute alles möglich ist – da war 2014 ja noch harmlos dagegen. Wie heute Falschmeldungen in kürzester Zeit Verbreitung finden und Menschen manipulieren, verbrannte Erde erzeugen. Da muss man nicht mehr wie Frau Schalek in den Schützengraben steigen und die Dinge ein bisschen übertreiben, sondern das geht aus der sicheren Distanz übers Netz, sogar mit Hilfe von KI.
Sie meinen "Ellen Babić"? Ja, das war doch sehr erfolgreich ... Der Autor Marius von Mayenburg schreibt fantastische Dialoge! Und dazu kommt die Handlung, die das Publikum einfach nicht loslässt, gerade weil sie mit gängigen Erwartungen spielt – und ihnen dann oft nicht entspricht.
Ja, aber auch sehr spannend. Und die Zuschauer scheinen das zu goutieren, dass nicht alles auf Anhieb erkennbar schwarz und weiß ist, dass manche Spuren verwischt sind und erst entdeckt werden müssen.
Sie decken eine unglaubliche Bandbreite an Rollen ab, werden für Klassiker wie Grillparzers Libussa oder die Alkmene in Kleists Amphitryon vom Publikum bejubelt, spielen aber auch viel zeitgenössisches Theater, das nicht immer den ungeteilten Zuspruch der Zuschauer erhält. Ihr Eindruck vom Wiener Publikum dürfte 1998 nach der Festwochen-Aufführung von Botho Strauss’ „Die Ähnlichen“ eher ambivalent gewesen sein ...
Ach, das haben Sie gesehen? Ich hoffe, Sie gehörten nicht zu den vielen Zuschauern, die damals schon vor der Pause das Theater in der Josefstadt verlassen haben! (lacht) Anfangen! (sie spricht es mit perfektem nasalen Wiener „Diphtong-A“) – das kann ich heute noch hören, wie’s aus dem Publikum gerufen wurde, als wir uns während der ersten fünf Minuten auf der Bühne die Haare gekämmt haben ... Aber das war wohl auch einfach das falsche Stück am falschen Ort. Es war ein Festival-Stück, aber im Publikum saßen Abonnenten, die wollten eben etwas anderes sehen – das ist ihr gutes Recht ... Aber mich hat es begeistert, und ich habe es auch gerne gespielt. Ich liebe Theater, das über das reine Amuse-Gueule, das es natürlich auch geben darf und soll, hinausgeht. Wenn dem Publikum nicht auf Anhieb gesagt wird Schaut mal, das ist dieser bestimmte Typ! und Seht mal, was ich jetzt denke!, sondern die Leute in den Sitzreihen ebenso gebeutelt werden wie die auf der Bühne. Das kann dann schon auch einmal ein wenig anstrengend sein. Aber au
Und ihrer Beziehung zu Wien hat es auch nicht geschadet, glaube ich?
Nein, auf keinen Fall. Also ich lebe jetzt seit 2009 in Wien und muss sagen, ich will nicht mehr nach Deutschland. Wien ist
meine Stadt.
Die sich in den letzten 16 Jahren doch unglaublich verändert hat. Bunter, jünger, eine unglaubliche Auswahl an Bars und Pop-up-Stores, Restaurants und Freizeit-Möglichkeiten – eine moderne europäische Metropole. Wie sehen Sie als „neutrale Beobachterin“ diese Veränderungen?
(lacht) Na so ganz neutral bin ich nicht. Wie gesagt, ich liebe diese Stadt. Aber ja, vielleicht typisch wienerisch, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits ist vieles natürlich toll, was gemacht wurde – aber leider wird eben vieles auch kaputt gemacht. Ich vermisse doch einige Dinge, die Wien zu Wien machten. Die kleinen Espressi und typischen Eck-Beisln! Das wird langsam alles „boboisiert“. Und wie halt vieles überhaupt so gnadenlos dem Tourismus geopfert wird. Diese Massen an Stadturlaubern innerhalb des Rings, mittlerweile fast zu jeder Jahreszeit! Im Sommer und zu Weihnachten versuche ich tatsächlich, die Innenstadt zu meiden!

Täterin und Opfer: Dörte Lyssewski im Erfolgs-Stück "Ellen Babic"
©Monika RittershausDas klingt wirklich schon erstaunlich wienerisch! Sie kommen ja ursprünglich aus Winsen in Niedersachsen, dem hohen Norden Deutschlands, haben in Hamburg Schauspiel studiert und hatten ihr erstes Engagement in Berlin. Wie haben Sie sich sprachlich in Wien zurecht gefunden?
Beruflich war das nie ein Problem. Auch Burgtheaterdeutsch ist schließlich Hochdeutsch. Da musste ich mich nie verbiegen. Und eine gewisse Färbung ist doch toll. Eine meiner ersten Rollen in Berlin war in Tschechows „Der Kirschgarten“ mit dem unvergessenen Peter Simonischek. Der hat gar nicht erst versucht, seine österreichische Färbung wegzubekommen – und das finde ich super! Es ist doch langweilig, wenn alles so glattgebügelt wird.
Aber privat: In Österreich läuft es sprachlich nicht so schnell wie in Deutschland.
Aber nicht so langsam wie in der Schweiz, Gott sei Dank. (lacht)
Sie haben in einem Interview einmal über die Schwierigkeit gesprochen, das in Österreich übliche „verbale Mäandern“ dechiffrieren zu können.
Stimmt, da ging es allerdings weniger um den Dialekt als darum, den Sinn hinter den Dingen zu erkennen, die oft nur umschrieben werden. Auch Gemeinheiten, die kann man auf Österreichisch auf beste Weise sagen, am elegantesten oder auch am ordinärsten. Und ja, das kann ich mittlerweile auch. Aber um zur Aussprache zurückzukommen: Wenn ich Sprecher-Rollen für deutsche Produktionen übernehme, bekomme ich doch manchmal zu hören, dass ich bitte nicht so österreichisch klingen soll! (lacht) Wäre aber auch schade, wenn 16 Jahre in Wien spurlos an mir vorübergehen ...
Apropos Sprecher: Sie haben für einige der berühmtesten Filme der Welt eine zweifache Oscar-Preisträgerin synchronisiert ...
Ah, Sie meinen Cate Blanchett, ja. Für die Herr der Ringe-Trilogie und einen Hobbit-Film. Das ist mit ein Grund, warum ich recht viele Angebote als Sprecherin für Dokumentarfilme bekomme.
Und warum haben Sie keine Spielfilme mehr synchronisiert?
Das ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Mein höchster Respekt an alle Kollegen, die das öfter machen. Man kann sprachlich nie seinen eigenen Rhythmus finden, muss sich nach jeder Mundbewegung richten und aufpassen, wann man Atem holt, schnieft, keucht, wo die Spucke ist – das ist purer Stress, während man so mit Kopfhörern im Studio steht. Aber Voiceover für Naturfilme, wenn die so ein bisschen ins Epische gehen, das macht Spaß, da kann man doch in gewisser Weise mitgestalten.
Am 25. Juli haben Sie mit „Die letzten Tage der Menschheit“ bei den Salzburger Festspielen Premiere. Davor wohl intensive Proben. Bleibt da überhaupt Zeit für Ferien, einen Urlaub?
Das ist mir gar nicht so wichtig. Wenn ein wenig Zeit bleibt, bin ich in meinem Haus im Burgenland. Aber in Salzburg bei den Festspielen habe ich auch noch eine Lesung im Landestheater, „Babyn Jar“ von Marianna Kijanowska, über das Massaker der Nazis 1941 an 33.000 Juden in der Ukraine. Und „Chronik eines Mordes – Jitzhak Rabin“ von Amos Gitai im Schloss Leopoldskron. Ich habe also einiges zu tun.
Und wie geht es in Wien weiter?
Am 5. Oktober kommen „Die letzten Tage der Menschheit“ als Premiere ins Burgtheater, „Ellen Babić“ läuft ebenso in der neuen Spielzeit wie Thomas Bernhards „Am Ziel“. Und es gibt einige Projekte, die noch nicht ganz spruchreif sind. Ach ja, übernächstes Jahr inszeniere ich in Klagenfurt eine Kombination aus Jelineks „Asche“ und Wolfi Bauers „Magic Afternoon“.
Das klingt richtig aufregend! Dabei haben wir über Ihre anderen Regie-Arbeiten gar nicht gesprochen!
(lacht) Das macht nichts, ich habe da keinen Druck. Ich bin nicht 25 und muss beweisen, dass ich eine tolle Regisseurin bin oder so.
Frau Lyssewski, vielen Dank für das Gespräch.


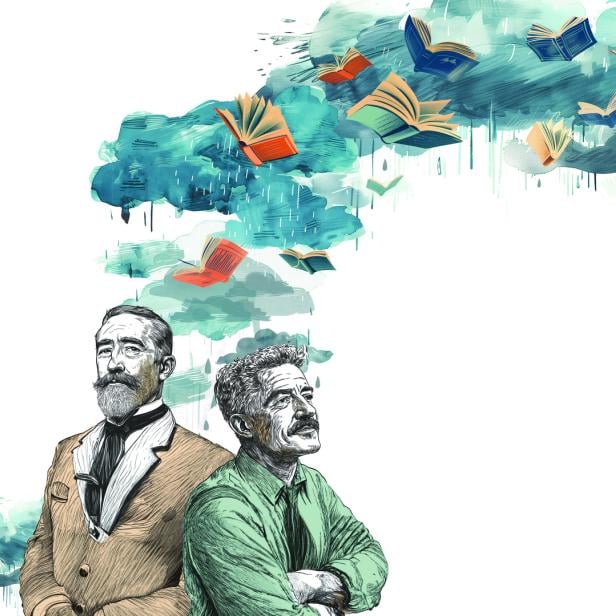

Kommentare