
Ruth Brauer-Kvam: "Alma wäre heute polyamourös"
An der Volksoper hat "Alma" am 26.10. Premiere. Regie führt Ruth Brauer-Kvam. Warum sie nun über Alma Mahler-Werfel anders denkt, und was sie ihr raten würde.
Am Abend zuvor war Ruth Brauer-Kvam noch im Musical Chicago an der Komischen Oper Berlin zu sehen. In Wien geht es gleich weiter mit den Proben zur Oper Alma von Ella Milch-Sheriff, die sie inszeniert. Es geht um Alma Mahler-Werfel: Komponistin, Muse und vor allem Femme fatale. Das Stück stellt ihre bisher kaum beachtete Seite in den Vordergrund: die Mutter. Ruth Brauer spricht mit der freizeit über die Ambivalenz der spannenden Protagonistin, über die Unterschiede zwischen Wien und Berlin und fehlende Langweile.
Wie war Ihre Meinung zu Alma Mahler-Werfel, bevor Sie sich mit dem Stück Alma befasst haben?
Ruth Brauer-Kvam: Ich fand die Frau faszinierend und vor allem die Zeit, in der sie gelebt hat, welche Männer sie kennengelernt hat. Aber das war immer ambivalent, weil man oberflächlich gehört hat: Sie war eine Männerfresserin und eine Muse. Und sie hat alle verrückt gemacht. Und sie war anstrengend und antisemitisch. Mein Bild von ihr ist nun komplexer geworden.
Inwiefern?
Nichts und niemand ist nur schwarz oder weiß. Jeder von uns ist ambivalent. So auch Alma Mahler-Werfel. Das ist auch das, worum es in der Oper geht. Es geht um Alma, die Mutter, um eine Frau, die mehrere Kinder verloren hat. Eines hat sie abgetrieben. Eins ist sehr früh gestorben, Manon mit 18 Jahren. Grauenhaft. Und Maria, ihr erstes Kind, ist mit vier Jahren gestorben. Frauen dieser Zeit mussten diese Traumata ohne Unterstützung und ohne das Wissen, das wir heute haben, verarbeiten. Sie hat versucht, das Trauma zu unterdrücken. Das macht schon etwas mit einer Frau. Und natürlich ist dieses berühmte Kompositionsverbot von Mahler interessant. Das ist auch differenziert und aus der Zeit heraus zu sehen.
Warum das?
Er hat gemeint: Bitte überlege dir das sehr gut. Und nur wenn du ganz sicher bist, dass du auf deine Musik für mich verzichten kannst, dann sag ja zu mir. Es war seine Bedingung für die Ehe. Und natürlich macht das etwas mit einem jungen Menschen, dessen Leidenschaft die Musik ist.

Ruth Brauer-Kvam auf der Probebühne der Volksoper in Wien. Gerade inszeniert sie dort Alma. Ende Dezember folgt eine neu einstudierte My Fair Lady.
©kurier/Wolfgang WolakWar sie als Musikerin verkannt?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich keine Musikerin bin. Ich glaube, sie war als Mensch und als intelligente Frau verkannt. Die kannte den Faust auswendig mit 15. Sie war dreimal in der Woche in der Oper. Sie war nicht irgendeine Göre aus Wien, die nur Party gemacht hat und die nur Männer verschlingen wollte. Sie wollte Mutter sein, einen Mann haben und heiraten. Das hat sie natürlich beschäftigt. Aber es war auch ein irrsinnig moderner Drang in ihr. Sie hat ganz klar geschrieben: Ich möchte eine Oper schreiben, die Welt verändert.
Und dann gibt es die antisemitischen Aussagen von ihr. Wird das bei der vielen Faszination auch übersehen?
Diese Art von Antisemitismus in Wien damals war so ein Kaffeehausantisemitismus. Der war Teil der Gesellschaft, aber sie war extrem. Trotzdem hat sie Mahler und Werfel geheiratet. Ein netter, empathischer Mensch war sie wahrscheinlich nicht. Aber höchst spannend.
Zur Person
Ruth Brauer-Kvam, wurde 1972 in Wien geboren und wuchs in Israel auf. Sie studierte am Tanz-Gesang-Studio Theater an der Wien, spielte auf der Bühne, in Film und Fernsehen. Seit einigen Jahren ist sie auch als Regisseurin tätig. Brauer-Kvam stammt aus einer Künstlerfamilie. Ihr Vater ist der Maler Arik Brauer, ihre Mutter die Sängerin Naomi Dahabani.
Was wäre sie heute für ein Typ? Würde man sagen, sie ist toxisch?
Ich glaube, sie wäre zum Beispiel eine Künstleragentin. Sie wusste sehr gut, was einen guten Künstler ausmacht. Wenn sie heute leben würde, würde ich mir wünschen, dass sie komponiert, egal ob gut oder schlecht. Ich würde ihr wahrscheinlich zur Therapie raten. Und wahrscheinlich wäre sie polyamourös. Auf jeden Fall würde es wild und frei zugehen.
Insofern wäre sie im Trend?
Oder aus der Zeit gefallen. Heutzutage wäre sie natürlich politisch höchst unkorrekt und würde wahrscheinlich gecancelt werden.
Wie gingen Sie an die Alma-Inszenierung heran?
Ich habe sehr viel recherchiert. Es ist kein typisches Biopic. Jeder Akt wird einem Kind gewidmet, das stirbt. Am Ende begräbt sie ihre Noten. Wir sehen Alma als über 50-jährige Frau, die sich weigert, zum Begräbnis ihres Lieblingskinds Manon zu gehen. Und wir sehen die Tochter Anna Mahler, die überlebt hat und Künstlerin geworden ist. Es geht um einen Konflikt zwischen Mutter und Tochter. Und man versteht etwas mehr, warum sie so geworden ist.

Bei Alma gibt es wohl kein Vorbeikommen an Paulus Mankers Stück. Besteht da die Möglichkeit, dass man da gewisse Sachen aus der Produktion einfließen lässt?
Nein. Wir machen etwas ganz anderes. Der Fokus sind die Kinder.
Sie kommen gerade von der Komischen Oper in Berlin, wo Sie in Chicago spielen. Gibt es Unterschiede zwischen der Theaterstadt Wien und der Theaterstadt Berlin?
Die Leute in Berlin mögen ihr Theater und sind offen für Experimente, was in der Wiener Klassikszene vielleicht nicht immer Fall ist. Aber die beste Stadt, um Kultur zu machen, ist und bleibt natürlich Wien.
Der große Berlin-Hype scheint vorbei. Es gibt viele Einsparungen im Kulturbereich. Wie nehmen Sie das wahr?
Wir müssen – nicht nur in Berlin – schauen, dass die Kultur an Bildung gekoppelt bleibt und die Politik versteht, dass Kultur Bildung ist. Dass gesunde Demokratie nur funktionieren kann, wenn wir gebildete Bürgerinnen und Bürger haben. Und ich glaube, es ist höchstgradig gefährlich zu sagen, wir kürzen die finanziellen Mittel. Wir Theatermenschen müssen mehr für die Bildung machen, in Schulen gehen und Formate schaffen, um für Aufklärung zu sorgen. Die Politik muss uns dabei unterstützen.
Gestern Berlin, heute Wien. Sie sind Regisseurin, Schauspielerin, Tänzerin, bildende Künstlerin. Wird Ihnen schnell langweilig?
Nein, nie, weil ich so viel zu tun habe. Ich sehe das nicht so als Arbeit. Es ist für mich mein Leben. Und es läuft gut, wenn ich ein gutes Team habe – und das habe ich.

Ruth Brauer-Kvam würde gerne in einem Zirkus arbeiten.
©kurier/Wolfgang WolakWas haben Sie noch nicht gemacht und würden aber gerne?
Modernen Zirkus, also nicht den mit wilden Tieren. Es gibt so tolle Menschen, die mit poetischen Formen Geschichten erzählen, mit ihren Körpern, mit Requisiten.
Sie kommen aus einer Künstlerfamilie. Stand bei Ihnen jemals zur Debatte, etwas anderes zu machen, als Künstlerin zu sein? Oder hätten Sie sich auch vorstellen können, in einer Bank zu arbeiten?
Nein, eigentlich nicht. Ich fand die Psychoanalyse und die Psychotherapie immer interessant. Ich habe das eine Zeit lang auch studiert. Das hat aber auch etwas mit meinem Job zu tun. Das nützt mir, wenn ich Regie mache oder wenn ich Figuren entwickle.
Sie inszenieren dann Ende Dezember die My Fair Lady in der Volksoper, wo es geheißen hat, die soll nicht mehr ganz so sexistisch sein. Wie gehen Sie das an?
Ich glaube, dass die jetzige Produktion, die ja schon sehr in die Jahre gekommen ist, ein wahnsinnig schönes Bühnenbild und schöne Kostüme hat. Das behalten wir auch alles bei. Mit der Neubesetzung, ein bisschen strafferen Dialogen und einer selbstbewussteren Eliza ist schon viel getan.


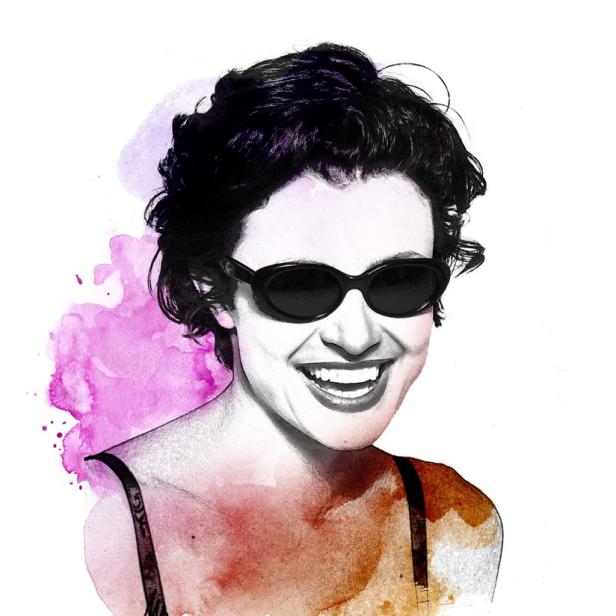



Kommentare