
Autorin Doris Knecht: "Alleine bedeutet nicht einsam“
Die Bestseller-Autorin über Neubeginn, die Lust am Alleinsein und das Bewahren von Erinnerungen.
Neubeginn. Das sagt sich leicht und fällt so schwer. In ihrem Buch „Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“ schreibt Doris Knecht über eine alleinerziehende Mutter Ende 50, die sich neu erfindet. Und doch Veränderungen eigentlich hasst. Doch jetzt steht ein neuer Lebensabschnitt an. Die Kinder ziehen aus, sie muss ihr Leben verkleinern und herausfinden, wer sie in Zukunft sein will. Der autofiktionale Roman ist ein Bestseller geworden und humorvoll und kurzweilig. Wie auch das Interview.
Das war mehr oder weniger der Plan. Der vorige Roman war ernst, es ging um Gewalt gegen Frauen. Die Gespräche dazu waren gut, aber oft auch deprimierend. Ich wollte ein fröhlicheres Buch schreiben, bei dem man nach der Lesung mit einem positiven Gefühl heimgeht.
Weiterlesen:
- Wer nicht in Knechts Kolumnen vorkommen darf
- Neubeginn: Geht das Leben nach 50 noch weiter?
- Männer? Nicht nötig
Ich wollte, dass es leicht und humoristisch ist, und das macht auch etwas mit einem selbst. Die Figuren in Romanen sind ja oft gescheiter als man selber. In der Nachbetrachtung fällt einem auf, welche Ängste man verarbeitet hat, was man vielleicht vorweggenommen hat oder man sich schönschreiben wollte.
Ich fand es spannend und zudem angenehm zu schreiben. Ich mache das ja schon länger, meine Kolumnen funktionieren ähnlich, allerdings muss ich mich da an Fakten halten. In einem Roman muss ich das nicht. Hier kann ich innerhalb dieses biografischen Gerüsts voller Fantasie herumspinnen und vieles zulassen: Also alles, was die Geschichte besser macht.
Tatsächlich, ja. Beim Schreiben taten sich immer wieder Räume mit Erinnerungen auf, bei denen ich merkte, die will ich gar nicht erst betreten.
Bei meinen Kolumnen haben meine Töchter irgendwann gesagt, sie wollen nicht mehr vorkommen. Das habe ich respektiert. Ungern zwar, weil ich immer fand, sie handeln ja nicht von den Kindern, sondern von Eltern, die mit ihrem neuen, von Kindern und ihren Lebensphasen dominierten Leben zurechtkommen müssen. Nur ganz selten schmuggle ich heimlich etwas von ihnen hinein, weil es grad so gut zu einem Thema passt. Zum Glück weiß ich, dass sie meine Kolumnen selten lesen.

Autorin Knecht: "Ich kann nicht gut loslassen. Das musste ich erst lernen"
©Kurier/Gilbert NovyDas stelle ich ihnen frei. Ich schenke sie ihnen, frage aber nicht danach. Manchmal merke ich, dass sie eines gelesen haben. Einmal ist mir aufgefallen, dass eine Tochter den Umschlag eines anderen Romans über meinen gestülpt hat, damit ich nichts davon bemerke. Sie wissen aber, dass ich nicht verantwortungslos mit ihnen und ihren Geheimnissen umgehen würde.
Eine Wohnung wird schnell zu groß und zu teuer, wenn die Kinder ausziehen. Man merkt, wie viel Zeug sich angesammelt hat. Brauche ich das noch? Falls nicht, was mache ich damit? Erinnerungen kommen hoch. Man weiß, wenn man das jetzt weggibt, entsorgt man damit eigentlich auch die Erinnerung daran. Nur eine kleine Kiste mit den allerwichtigsten Erinnerungen habe ich mir aufbewahrt. Ich fand es letztlich irrsinnig befreiend, viel wegzugeben und jetzt mit eher wenigen Dingen zu leben.
Ich kann nicht gut loslassen. Das musste ich erst lernen. Aber es hat gut getan. Ich vermisse nur wenige von den Dingen, die ich weggegeben habe. Manchmal sind Erinnerungen ja auch schmerzhaft, und es ist gut, auch sie wegzugeben. Bei manchen Sachen tut man sich schwer, sie zu verzeihen, es ist einfacher, sie zu vergessen. Und es ist auch heilsam.
Meinen Computer. Kunst. Fotos von den Kindern. Ein paar Geschenke, die sie mir gemacht haben.
Das habe ich à la Marie Kondo gelöst: Die Zeichnungen einmal noch angesehen, mich gefreut – und mir dann gesagt: Ich habe noch ein paar andere, diese kann weg.

Literatur im Café: Knecht im Interview mit Redakteur Alexander Kern
©Kurier/Gilbert NovyErfolg ist in unserer Gesellschaft damit verknüpft, möglichst viel zu besitzen. Von der Villa bis zum SUV. Es fällt schwer, diese Denkweise aufzugeben und von 140 m² auf 40 zu ziehen. Man muss sich und anderen erklären, dass das jetzt kein sozialer Abstieg ist – weil das für gewöhnlich so gesehen wird. Aber ich brauche nicht so viel Platz für mich allein und zahle weniger Miete. Zudem ist es gut für den Planeten. Der Trend geht ja auch zum Downsizing.
Was ich habe, ist nicht wenig. Ein kleines, einst um sehr wenig Geld gekauftes Haus am Land mit einem großen, verwilderten Garten. Eine kleine Wohnung. Ich bin sehr privilegiert.
Vielleicht. Ich entspreche wahrscheinlich diesem Klischee einigermaßen. Wie so viele Leute hat sich auch bei mir Ende 30 und mit Kindern dieser Naturwunsch gemeldet.
Ich war 19 und kam aus der katholischen Provinz. Es gab klare Vorstellungen, was ein sicheres Leben ist, vor allem für eine Frau, nämlich mit einem Ehemann in einem geschützten, überschaubaren System namens Familie. Da auszubrechen war gar nicht so leicht, selbst damals in den Achtzigern. Das war ein großer Schritt für mich. Das Schöne daran ist, dass daraus kein Bruch mit meiner Familie wurde. Ich habe ein sehr liebevolles Verhältnis mit meinen Eltern und meinen Geschwistern.
Irgendwann kommt eine Frau in eine Lebensphase, in der sie nicht mehr zwingend einen Mann braucht.
Ich komme in ein Alter, das mit sehr negativen Emotionen behaftet ist. Die Leute haben Angst, dass die Kinder ausziehen, vor Einsamkeit, vor Krankheit, vor Veränderung. Viele Bücher widmen sich Frauen, die ohne Partner vereinsamen bzw. wenn sie keine praktizierenden Mütter mehr sind. Dem wollte ich eine neue Erzählung hinzufügen: Das Leben geht auch nach Fünfzig noch weiter. Und alleine zu leben bedeutet nicht, einsam zu sein.
Ich lebe gern allein. Und bin gut aufgehoben in einem dichten Netz von Freundinnen und Freunden. Ich mag es selbstbestimmt und brauche zum Schreiben einfach viel Ruhe.
Ich hatte bestimmte Vorstellungen vom Leben. Dazu gehörten unbedingt Familie und irgendwann ein Ort in der Natur. Wenn man nicht schon als Erbin auf die Welt kommt, dann braucht man einen Zweiten, der da mitmacht. Es ist super, einen guten Partner zu haben, mit dem das funktioniert. Irgendwann kommt eine Frau aber in eine Lebensphase, in der sie nicht mehr zwingend einen Mann braucht. Man lebt von seiner eigenen Arbeit, man hat Freunde. Ich finde die Entwicklung auch interessant, dass immer mehr Paare um die 70 sich scheiden lassen, es gibt offenbar sogar einen Begriff dafür: Silver Splitters. Soweit ich weiß, geht das offenbar relativ oft von den Frauen aus.
Es gibt noch sehr sehr viel zu tun. Und ich finde, der Großteil dieser feministischen Arbeit sollte jetzt mal von den Männern erledigt werden. Die Frauen sagen seit Jahrzehnten, wo sie ungerecht behandelt werden, wo ihr Leben signifikant schlechter ist, was sie brauchen, was sie wollen, was ihnen zusteht: Die Männer müssen endlich dafür sorgen, dass sie es auch bekommen. Ich sehe viele Männer, die „Feminist“ auf ihren T-Shirts stehen haben, aber ich sehe auch viele, die davon nichts mehr hören wollen, sobald es für sie etwas unbequem wird.





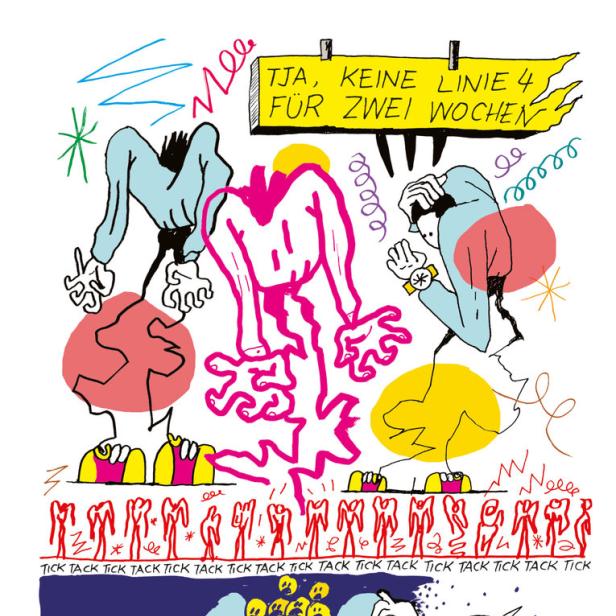
Kommentare