
Die "Let Them Theory" und der neue Hype um die Gelassenheit
Die virale Theorie erobert auch in Österreich die Bücherregale. Eine Psychologin erklärt, wo die Grenzen des Konzepts liegen und wie es unser Leben tatsächlich verbessern kann.
Deine Freunde laden dich nicht zum Brunch ein? Der Kollege macht eine bissige Bemerkung? Die Kinder rufen zu selten an? Die Erfolgsautorin Mel Robbins (siehe unten) liefert in ihrem Weltbestseller das Patentrezept für solche Fälle: Let them! Zu Deutsch: Lass sie! Seit Kurzem ist das grellgrüne Buch auf Deutsch erhältlich und zu einer beliebten Sommerlektüre geworden. Auch Raphaela Plasch, Psychologin und Coach in Wien, hat es gelesen – und sagt im KURIER, was von der viralen Theorie zu halten ist.
KURIER: Warum, glauben Sie, hat die „Let them“-Theorie so einen Nerv getroffen?
Raphaela Plasch: In der „Let Them Theory“ von Mel Robbins geht es darum, Dinge loszulassen und die Verantwortung für Umstände abzugeben, auf die wir keinen Einfluss haben. Das soll die Selbstwirksamkeit und inneren Frieden fördern. Ich denke, es trifft einen Nerv, weil es ein sehr individualistischer Zugang ist und unsere westliche Welt gerade sehr nach Individualismus strebt. Außerdem erleben viele Menschen in der heutigen Zeit, insbesondere Frauen und Mütter, einen hohen Mental Load. Sich teilweise dieser mentalen Belastung zu entledigen, kann sehr erleichternd sein.

Raphaela Plasch ist Psychologin und Coach in Wien.
©Iris Amalia PhotographyIn welchen Situationen würden Sie empfehlen, die Theorie anzuwenden?
Die Let-Them-Theory ist hilfreich, wenn es um Entscheidungen anderer geht, die wir nicht beeinflussen können und über die wir keine Kontrolle haben – zum Beispiel, wenn uns jemand nicht zu einem Event einlädt oder nicht wie versprochen anruft. Auch gibt es viele Menschen, die dazu neigen, zu viel Verantwortung für andere zu übernehmen. Ich kann jedoch nur verändern, worauf ich selbst Einfluss habe – hier sprechen wir von Selbstwirksamkeit, die in der Psychologie und in der Therapie eine wichtige Rolle spielt. Auch kann das Konzept hilfreich sein in Hinblick auf Toleranz – wir dürfen Menschen so akzeptieren, wie sie sind, und sie ihr Leben so leben lassen, wie sie es für richtig halten. Wichtig ist, dass wir daraus unsere Schlüsse ziehen.
Fakten
Geschichte
Die Idee der inneren Ruhe gegenüber dem Unkontrollierbaren gab es schon im Alten Rom (Stoa). Sie ist auch eine Säule des Buddhismus.
Bestseller
Seit der Veröffentlichung im Dezember 2024 hat sich die „Let Them Theory“ mehr als fünf Millionen Mal verkauft, berichtet der Guardian.
Deutsche Ausgabe
„Zwei Worte, die dein Leben verändern werden: Die Let Them Theorie“ von Mel Robbins ist Anfang Mai im Goldmann-Verlag erschienen.
368 Seiten, 21,50 €.
Podcast
In „The Mel Robbins Podcast“ spricht die Autorin über Selbsthilfe-Tools und Erkenntnisse der Neurowissenschaft.
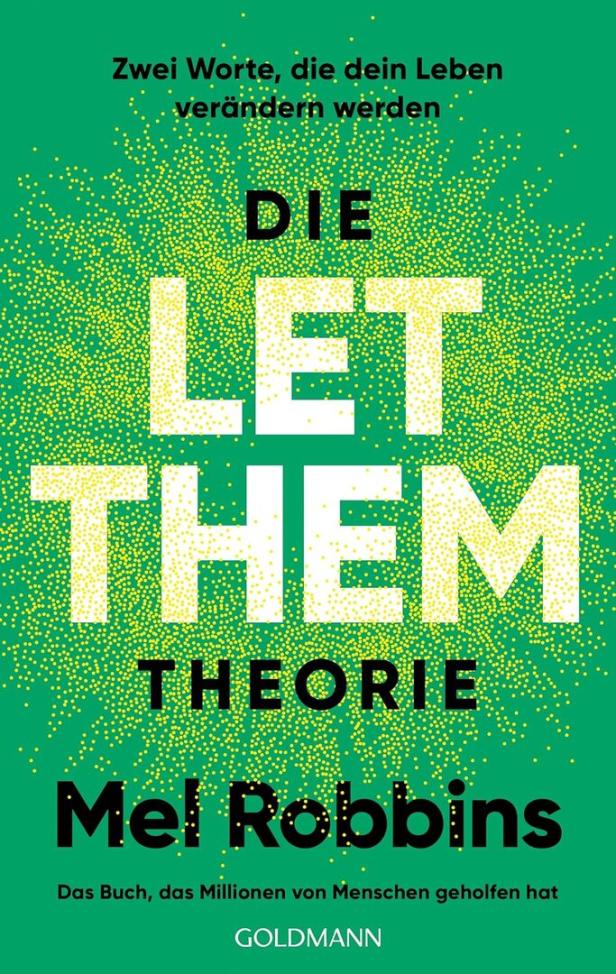
Wann wäre der Ansatz Ihrer Meinung nach fehl am Platz?
Dass uns das Verhalten anderer Menschen gelegentlich verärgert oder enttäuscht und wir es ändern wollen, ist nicht nur schlecht. Ärger zeigt uns: He, das ist nicht okay – ich will das nicht. Das Konzept birgt die Gefahr, dass wir nicht ausreichend für uns und unsere Grenzen einstehen und Dinge einfach hinnehmen. Gerade für Menschen, die sich schwer damit tun, ihre Emotionen und Bedürfnisse zu äußern, könnte das emotionale Unterdrückung und Grenzüberschreitungen durch andere bedeuten.
Für ihren Ansatz musste Mel Robbis auch viel Kritik einstecken – zu Recht?
Die Theorie liefert, wie die meisten Persönlichkeitsentwicklungskonzepte, einfache Antworten auf komplexe Zusammenhänge. Abseits der erwähnten Grenzüberschreitungen kann so ein Konzept in der Extremform Gift für unsere Gesellschaft sein. Mit dem „Lass sie“ machen wir es uns gegebenenfalls auch sehr leicht. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der wir Menschen so sein lassen, wie sie sind, wo jedoch nicht jeder ohne Konsequenzen tun und lassen kann, was er möchte. Es gibt Themen, da sollten wir nicht wegsehen und die Umstände einfach sein lassen. Ich weiß zum Beispiel nicht, inwiefern uns die Let-them-Theory in Bezug auf den Klimawandel weiterhilft. Auch sollten wir bei Fehlverhalten anderer wie Gewalt oder Mobbing nicht einfach wegsehen, weil es „nicht unsere Baustelle“ ist. Toleranz sollte nicht in Ignoranz ausarten.
Phänomen Mel Robbins: Ein Guru für Dauergestresste
Es sei das beste Selbsthilfebuch, das sie seit Langem gelesen habe, soll Oprah Winfrey über die „Let Them Theory“ gesagt haben. Der einflussreiche US-Megastar ist Teil einer riesigen Fangemeinde, die sich Autorin Mel Robbins in den vergangenen Jahren auf dem umkämpften Selbsthilfe-Markt aufgebaut hat.
Wie viele Erfolgsgeschichten beginnt auch die von Mel Robbins ganz unten – mit einem Burn-out und Schuldenberg. Weil die Juristin und junge Mutter aus Vermont nicht mehr aus dem Bett kam, entwickelte sie die „5-Sekunden-Regel“ und ging damit erstmals auf Tiktok viral. Die einfache Technik soll helfen, angstgesteuertes Verhalten durch schnelles, bewusstes Handeln zu überwinden (indem man von fünf herunterzählt und dann aktiv wird).
Ähnlich simpel klingt auch ihre „Let Them Theory“, die Ende 2024 in Buchform erschien und seitdem in viele Sprachen übersetzt wurde. Rasch entwickelte sich der Titel zu einem radikalen Mantra für Dauergestresste und „Overthinker“.
Ausschlaggebend für den späteren Bestseller war ihre Teenager-Tochter, erzählt Robbins bei Auftritten und in ihrem Podcast. „Lass sie doch“, soll Kendall Robbins ihrer Mutter gesagt haben, als diese wegen der Organisation eines Schulballs verzweifelte. Der Satz habe ihr Leben verändert, so Robbins, die mit ihrem Ehemann Chris in einer offenen Ehe lebt. Vorwürfe, sie habe den Titel von einem Gedicht entlehnt, streitet die 56-Jährige ab.
Doch mit dem Erfolg werden auch die Kritiker lauter. Wie sie damit umgeht, wollte der Guardian wissen. Ganz einfach: „Let Them“.
Was kann man sich von der Autorin abschauen?
Wir können uns das Leben oft leichter machen, wenn wir uns darauf konzentrieren, was in unserem Einflussbereich liegt und Dinge akzeptieren, die wir nicht beeinflussen können. Ärger über das Wetter, über den verpassten Zug oder den Kommentar einer Bekannten vor zehn Jahren kosten unnötig Energie. Wir sollten jedoch immer reflektieren, wo unsere Verantwortung liegt und wo nicht. Ist es mir wert, diesen Kampf zu kämpfen? Hat es Mehrwert für mich, für die Gesellschaft? Sich diese Fragen zu stellen, kann helfen.

Kommentare